
Für Dialektik in Organisationsfragen
Besichtigung der Grundrechte
Teil 3 – Artikel 9: Das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden und das Koalitionsrecht
Der Artikel 9 handelt von Organisationen: von Vereinen und Gesellschaften (Absatz 1 und 2) und von Gewerkschaften und „Arbeitgeber“verbänden (Absatz 3, „Koalitionsrecht“). Parteien sind in diesem Artikel nicht enthalten. Sie spielen eine besondere Rolle im Parlamentarismus, haben bestimmte Privilegien und bestimmte Pflichten. Das werden wir uns bei der Besichtigung des Artikels 38 (Wahlrecht) genauer ansehen. Ebenso sind hier Religionsgemeinschaften nicht enthalten, deren Rechte und Freiheiten wir unter Artikel 4 besichtigen können.
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
Die völkische Ansage „alle Deutschen“ ist reaktionärste Schublade (siehe dazu der Kasten „Nur für Deutsche!“).
Vereine im Sinne dieses Artikels sind nicht nur irgendwelche Interessengemeinschaften, die in der Regel auf der demokratischen Ebene des gleichen Stimmrechts aller Mitglieder funktionieren. Auch die Freiheit, wirtschaftliche Vereinigungen, also Kapitalgesellschaften zu bilden (wie etwa Aktiengesellschaften, GmbHs usw.) wird mit diesem Grundrecht garantiert. In diesen Gesellschaften gibt es keine Gleichheit der Mitglieder, sondern die Stimmen richten sich nach der Kapitaleinlage. Eine „Wirtschaftsdemokratie“, von der manche Gewerkschaftsführer träumen, ist nur eine Illusion.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.
Hier haben wir wieder die uns schon wohlbekannte „verfassungsmäßige Ordnung“, gegen die nicht verstoßen werden darf – eine nicht fassbare Kategorie, entsprechend der Totalitarismus-Theorie gleichermaßen gegen Antifaschisten und Faschisten gerichtet, und damit ganz im Sinne des Anti-Antifaschismus des Grundgesetzes in seiner Gegnerschaft gegen das Potsdamer Abkommen (siehe Teil 1 dieser Serie – Artikel 14).
Aber dann kommt etwas, das sich auf den ersten Blick sehr herzerwärmend liest. Vereine und Gesellschaften dürfen sich nicht gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten. Das ist doch vollkommen richtig! Aber dann wird man auf den zweiten Blick nachdenklich: Wo bitte pflegen denn die großen Kapitalgesellschaften, die Konzerne, den Gedanken der Völkerverständigung? Waffenlieferungen, Zerstörung der Wirtschaft anderer Länder, Verelendung, Ausplünderung, das ist die „Völkerverständigung“ dieser Bande! Warum sind die nicht alle nach diesem Grundgesetzartikel verboten?
Um zu verstehen, was hier eigentlich mit Völkerverständigung gemeint ist, wollen wir uns ein Beispiel ansehen. Im Jahr 1993 verbot Bundesinnenminister Kanther (CDU) die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) samt allen wirklichen und vermeintlichen Teilorganisationen (dass die PKK Partei heißt, hat in diesem Fall juristisch nichts zu sagen – ihre Organisationsform in der BRD ist die eines Vereins). Das Verbot wurde später vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Sowohl das Bundesinnenministerium als auch das Bundesverfassungsgericht berufen sich dabei u.a. darauf, die PKK verstoße gegen den Gedanken der Völkerverständigung.
Für Internationalisten und Antifaschisten ist das vollkommen unverständlich. Wie kommen die darauf?
Die Zeitung junge Welt fragte in einem Interview den Rechtsanwalt Lukas Theune, warum die Bundesregierung auf der Kriminalisierung der PKK beharrt. Seine Antwort: „Da stehen ganz klar wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Deutsche Unternehmen sollen mit der Türkei gut kooperieren können. Man will in der Außenpolitik keine diplomatischen Verwicklungen riskieren.“[1]
Präziser kann man nicht ausdrücken, was die deutsche Bourgeoisie mit „Völkerverständigung“ meint und immer gemeint hat. Der faschistische Kampfhund Erdogan muss für die deutschen Kapitalinteressen bei Laune gehalten werden!
Als die Freie Deutsche Jugend (FDJ) 1954 vom Bundesverwaltungsgericht verboten wurde, ging es dem Gericht nur um die „verfassungsmäßige Ordnung“. Die FDJ hatte selbst zu ihrer Verteidigung ausgeführt, dass sie die Erziehung der westdeutschen Jugend zur Völkerverständigung als Aufgabe sieht. Da war es für das Gericht wohl zu dünnes Eis, sich auf die Gegnerschaft zum Gedanken der Völkerverständigung zu berufen. Stattdessen gab es eine ellenlange Beweisführung zur „verfassungsmäßigen Ordnung“, die auf nichts anderes hinausläuft als auf die Beschneidung der Meinungsfreiheit.
Man sieht, der Absatz 2 dieses Artikels hat für alle Gelegenheiten das passende Instrumentarium.
Sehen wir uns nun mal den entsprechenden Artikel in der Verfassung der DDR von 1949[2] an. Das ist schon viel lockerer gestaltet als im Grundgesetz. Da heißt es nur: „Alle Bürger haben das Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine oder Gesellschaften zu bilden.“ Die Vereine mussten sich also nicht um eine „verfassungsmäßige Ordnung“ und sonstige Vorschriften kümmern. Sie durften nur nicht gegen die Strafgesetze verstoßen.
Nun gab es zwischen der Strafgesetzgebung der BRD und der der DDR einen drastischen Unterschied. Die DDR brachte die Strafgesetzgebung in Übereinstimmung mit dem Potsdamer Abkommen, das u.a. die Entmilitarisierung Deutschlands vorschreibt. In diesem Sinne wurden die Schützenvereine verboten. Sie lebten erst mit der Annexion der DDR durch die BRD wieder auf.
Überhaupt nicht mit dem Grundgesetz zu vergleichen, ist die besondere Einbindung von Vereinen (einschließlich der Gewerkschaften) in die Volksvertretungen der DDR (Artikel 13, siehe Tabelle). Damit wurde schon während der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung der Parlamentarismus angegriffen und revolutionäre Vorformen geschaffen, die gesetzgebende und vollziehende Gewalt schließlich in eine Hand zu legen.
(Absatz 3, Satz 1 und 2) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.
Den Absatz 3 dieses Artikels müssen wir in zwei Teile trennen. Satz 1 und 2 sind seit 1949 im Grundgesetz enthalten. Satz 3 wurde 1968 hinzugefügt und hat für so viel Verwirrung gesorgt, dass wir Satz 1 und 2, also die ursprüngliche Fassung, erstmal ohne diese Ergänzung besichtigen werden.
Es handelt sich hier um das sogenannte Koalitionsrecht, das Recht, sich in Gewerkschaften oder „Arbeitgeber“verbänden zu organisieren.
Muss das so sein in einer demokratischen Republik?
Vergleichen wir mal die Formulierung des Absatzes 3 mit der entsprechenden Formulierung der Verfassung der DDR von 1949 (siehe Tabelle). Im Grundgesetz heißt es: „Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“. In der Verfassung der DDR von 1949 heißt es: „Lohn- und Arbeitsbedingungen“. Dort ist also nur von dem Organisationsbedürfnis der Arbeiter die Rede, d.h. nur der Gewerkschaft. Den Vergleich können wir noch fortsetzen, wenn es im Grundgesetz heißt „für jedermann und für alle Berufe“, während in der DDR-Verfassung von 1949 die Formulierung „alle Berufe“ fehlt. Denn der „Beruf“ des „Unternehmers“ war zwar in der DDR noch vorhanden, aber entsprechende Vereinigungen waren verboten. Dafür war schon vor Gründung der DDR gesorgt worden, während es in Westdeutschland in die umgekehrte Richtung ging:
„Während die Konzernherren in ihren Schlupflöchern und in den Gefängnissen auf bessere Zeiten warteten, leiteten überall in Deutschland die Arbeiter die Betriebe und setzten die Produktion in Gang, ohne dass ihnen dabei die Konzernherren gefehlt hätten.
In der sowjetisch besetzten Zone wurden diese Herren sofort auf die Straße gesetzt, und unter Anleitung der Kommunisten und der fortschrittlichen Sozialdemokraten eine Friedensproduktion unter Kontrolle der Arbeiterklasse für die Versorgung der Bevölkerung in Gang gesetzt. Die Großbanken, die zu den Hauptträgern der faschistischen Welteroberungspolitik gehörten, wurden geschlossen. Sämtliche Unternehmerorganisationen wurden verboten. Schließlich waren es diese Organisationen gewesen, die schon im 1. wie im 2. Weltkrieg die Hauptkriegstreiber waren.
Ebenso wie die rechten Gewerkschaftsführer und Hauptspalter die Entfernung der faschistischen Fabrikdirektoren, Vorstände und Aufsichtsräte nicht für so notwendig hielten (…), liebäugelten sie auch schon wieder mit den Unternehmerorganisationen.
Paul Harig berichtet:
‚Als er (der IG-Metall-Führer Walter Freitag) in den Saal rief: ‚Die Unternehmer sollen sich nun auch endlich organisieren‘, brach ein ungeheurer Proteststurm aus. Minutenlang konnte sich Freitag nicht mehr Gehör verschaffen, bis es ihm gelang zu sagen: ‚Wir brauchen doch einen Tarifpartner‘.‘
Die Sorge hätte man den Herren Gewerkschaftsführern nehmen können, wenn sie sie wirklich gehabt hätten. Tarifpartner waren in der sowjetisch besetzten Zone z.B. die Industrie- und Handelskammern, wo ja schließlich die Unternehmer vertreten waren, aber durch die Mitbestimmung der Arbeiter dort auch kontrolliert werden konnten.“[3]
Die Sorge vieler Kollegen, dass die Kapitalisten nicht in Unternehmerverbänden organisiert sein könnten und sich damit vor Tariflöhnen drücken, ist uns bis heute geblieben. Aber wenn ein Kapitalist aus solch einem Verband austritt, dann sind wir doch nicht aus der Gewerkschaft ausgetreten! Das Problem ist nicht der betreffende Kapitalist, sondern dass wir unsere gemeinsame Kraft und Solidarität mit den betroffenen Arbeitern, unsere Fähigkeit zu streiken, nicht genügend nutzen, um dieses so schlaue Würstchen von Kapitalist zur Zahlung der Tariflöhne zu zwingen.
So weit, so unbefriedigend in Bezug auf die BRD und das Grundgesetz. Schauen wir noch einmal auf die Tabelle, und wir stellen fest: Was wir im Grundgesetz an Unternehmerverbänden zu viel haben, haben wir an anderer Stelle zu wenig. Da fehlt das Streikrecht – im Gegensatz zur DDR-Verfassung von 1949. Es wurde von den „Vätern des Grundgesetzes“ keineswegs vergessen. Ursprünglich lag beim Parlamentarischen Rat ein Entwurf für einen Absatz 4 des Artikels 9 vor. Er lautete:
„Das Recht der gemeinschaftlichen Arbeitseinstellung zur Wahrung und Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen wird anerkannt. Seine Ausübung wird durch Gesetz geregelt.“[4]
Selbst dieser ins Auge gefasste Absatz 4 schränkt das Streikrecht eher ein, denn er erkennt nur den ökonomischen, nicht den politischen Streik an. Trotz seiner Harmlosigkeit hat es dieser Entwurf nicht ins Grundgesetz geschafft. Er wurde auf Antrag von Dr. Eberhard (SPD) gestrichen. Zur Begründung hieß es, „dass es unmöglich sei, die erforderlichen kasuistischen Einschränkungen des Streikrechts in Absatz 4 einzubauen“.[5] Sozialdemokratische Pedanterie vom Feinsten – zur Freude des Kapitals.
Seit Bestehen des Grundgesetzes fristet das Streikrecht ein äußerst bescheidenes Dasein, beschnitten durch das Tarifrecht, das die Arbeiter auf Tarifverträge und Friedenspflichtet festnageln soll. Dass wir im Gegensatz zu den Arbeitern anderer Länder so auf die Tarifverträge fixiert sind, statt mit Generalstreik, mit politischen Streiks unsere Verelendung und die faschistische Gefahr aufzuhalten, ist allerdings nicht Schuld des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist wie jedes Gesetz Ausdruck des Kräfteverhältnisses. Und da schadet die Begeisterung mancher Kollegen für das Grundgesetz eher, als dass es unserer Kampfkraft nützt.
Und noch eins sollte sich jedes Gewerkschaftsmitglied klar machen: Streik ist nach der Rechtslage in diesem Land keine kriminelle Handlung, für die man bestraft und ins Gefängnis gesteckt werden kann – noch gibt es hier eine, wenn auch beschädigte, bürgerliche Demokratie. Rechtlich sieht es bei Verstoß gegen die „Friedenspflicht“ so aus, dass die Kapitalisten Schadenersatzforderungen stellen können – die bei einem erfolgreichen Streik aber auch weggestreikt werden können – man muss es nur wollen und die eigene Kraft auch nutzen! Strafrechtlich verfolgt wurden schon Streikposten, die Streikbrecher und Materiallieferungen aufhalten wollten, oder Kollegen, die eine Straße blockierten. Da kommt dann auch die Polizei ins Spiel. Das ist ein Kampf, der geführt werden muss, und da hilft es uns gar nichts mit dem Grundgesetz zu wedeln.
(Absatz 3, Satz 3) Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.
1968 wurden gegen den Protest von Hunderttausenden die Notstandsgesetze in das Grundgesetz eingefügt. Sie erlauben es, die bürgerliche Demokratie zu zerstückeln, den Bundestag nach Hause zu schicken und den Bürgerkrieg gegen Arbeiter und Antifaschisten zu eröffnen. Auch der Satz 3 des 3. Absatzes von Artikel 9 ist im Zuge der Notstandsgesetze entstanden.
Dazu heißt es in der KAZ Nr. 346 (2014):
„Das sogenannte Streikrecht in der BRD
Die gerade in den Gewerkschaften oft gemachte Aussage bzw. geäußerte Annahme, das Streikrecht sei im Grundgesetz festgelegt und verankert, trifft so nicht zu. Wäre das der Fall, könnte es nicht immer wieder bei allen sich bietenden Gelegenheiten (betrieblichen und gewerkschaftlichen Streiks) vom Kapital angegriffen und danach von Arbeitsrichtern immer wieder neu ausgelegt bzw. ausgerichtet werden. Zu diesem Sachverhalt hat die oben bereits zitierte Arbeitsgerichtspräsidentin (gemeint ist hier die Präsidentin des BAG, Ingrid Schmidt, d. Verf.) in einer Presseerklärung zum genannten BAG-Urteil festgestellt: ‚Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist nicht freiwillig in die Rolle des Ersatzgesetzgebers geschlüpft, sondern nur deshalb, weil es Konflikte, aber keine gesetzlichen Regelungen für Arbeitskämpfe gibt.‘
Also ist klar, es gibt die gesetzliche Regelung des Streikrechts nicht. Seit dem Bestehen der BRD wird es der Arbeiterbewegung in diesem Lande durch Urteile der Klassenjustiz als sogenanntes Arbeitskampfrecht diktiert – folgt man dabei der Frau Präsidentin: unfreiwillig! Hierbei ist im Grundgesetz nicht von Streiks, sondern von Arbeitskämpfen die Rede, die ‚zur Wahrung- und Förderung der Wirtschaftsbedingungen ... geführt werden.‘
(…)
Zu diesem Recht gehört dann auch, durch Urteile bestätigt, das Recht des Kapitals komplette Belegschaften als Abwehrmaßnahme gegen einen Streik „zur Förderung seiner Wirtschaftsbedingungen“ durch Aussperrung auf die Straße zu jagen. Hierzu gehört ebenso das Recht der Kapitalisten anzugreifen, daher kommt der Begriff der ‚Angriffsaussperrung‘. Was das dann für ein Streikrecht sein soll, kann sich jeder ausmalen. Die Gesetzeskommentierungen und die Arbeitshefte der Gewerkschaften dazu füllen einige Regale. Doch zurück zum Streik. Tatsache ist, dass sich Gewerkschaften wie Arbeitsrichter in der Frage auf den Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz berufen. Der ist im Zusammenhang mit dem Kampf klassenbewusster Arbeiter gegen die Notstandsgesetzgebung auf Betreiben der SPD ins Grundgesetz aufgenommen worden, weil die Arbeiter befürchteten, dass ihnen das Recht zu streiken genommen wird. Auf diesem Wege ist die falsche Annahme, das Streikrecht sei im Grundgesetz verankert, entstanden und der Artikel 9 Absatz 3 wird deswegen auch häufig als der ‚Streikparagraph‘ bezeichnet.“[6]
Man muss sich doch nur mal die Grundgesetz-Artikel ansehen, in deren Zusammenhang dieses sogenannte Streikrecht genannt wird (siehe Fußnote zu der Tabelle). Wenn das umgesetzt wird, dann brennt die Erde! Dann gehen sie mit Bundespolizei und Bundeswehr auf uns los. Dann ist Bürgerkrieg! Als die SPD in der Großen Koalition die Notstandsgesetze mit beschlossen hat, da ist ihr mit erstaunlichem Erfolg gelungen, einige politisch und gewerkschaftlich engagierte Arbeiter hinters Licht zu führen. Genau das war auch damals ihre Aufgabe in der Großen Koalition. Aber wenn der Bürgerkrieg gegen uns eröffnet wird, dann hilft uns doch kein normaler Tarifkampf mehr. Dann geht es um Generalstreik, um Betriebsbesetzungen, um Arbeitermilizen. Der DGB hat 1968 im Einvernehmen mit der SPD auf einen Generalstreik gegen die Notstandsgesetze verzichtet. Und als Konsequenz davon sollen uns dann die Notstandsgesetze ein Streikrecht eingeräumt worden sein? Nein, ganz im Gegenteil. Die Anerkennung der Aussperrung haben wir uns eingehandelt, wie in dem oben zitierten Artikel ausgeführt.
Das Streikrecht müssen wir uns noch erkämpfen – indem wir streiken!
Und so geht es weiter:
Im 4. Teil der Serie besichtigen wir Artikel 38 – das Wahlrecht, und damit zusammenhängend die Rechte und Pflichten der Parteien, die ja in dem Artikel 9 ausgeklammert sind. Im 5. Teil kommen wir noch einmal zurück auf den politischen Streik und andere Widerstandsformen – und klopfen daraufhin den Artikel 20 Abs. 4, das Widerstandsrecht, ab.
E.W.-P.
Information zur Serie
Aus dem Vorwort:
Die Grundrechte – Antifaschisten, Demokraten waren es bisher, die für die Verteidigung der Grundrechte stritten und demonstrierten. Wie ist es möglich, dass nun eine Masse nörgelnder, unter „Maskendiktatur“ schmachtender und sich überhaupt betrogen fühlender Kleinbürger, angeführt von Reichskriegsflaggen und sonstigem hochkriminellen Nazigesocks sich die Forderung nach Einhaltung der Grundrechte zu eigen macht, ja sich aufführt, als wären sie die Erfinder der Verteidigung der Grundrechte.
Es wird höchste Zeit, hier um Klarheit zu kämpfen. Deshalb die Einladung zur Besichtigung der Grundrechte, wie sie im Grundgesetz in den ersten 22 Artikeln geschrieben stehen (Artikel 1 bis 19 und Artikel 12a, 16a und 17a), sowie die Artikel 20 Abs. 4 (Widerstandsrecht), 33 (Gleicher Zugang zu öffentlichen Ämtern), 38 (Wahlrecht), 101, 103 und 104 (Grundrechte gegenüber der Justiz). Diese Besichtigung ist eine Serie in der KAZ, wobei jeder Teil dieser Serie ein abgeschlossener Artikel ist.
Bisher erschienen:
Vorwort zur Serie:
KAZ Nr. 373, S. 8, www.kaz-online.de/artikel/besichtigung-der-grundrechte
Teil 1 – Artikel 14: Das Eigentum: KAZ Nr. 373, S. 9, www.kaz-online.de/artikel/besichtigung-der-grundrechte-1
Teil 2 – Artikel 2: Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person: KAZ Nr. 374, S. 23, www.kaz-online.de/artikel/besichtigung-der-grundrechte-2
Nur für Deutsche!
Anmerkung zu den Grundgesetzartikeln 8, 9 (1), 11, 12 (1), 20 (4) und 33
Im Grundgesetz sind Grundrechte enthalten, die für alle gelten, und Grundrechte, bei denen es heißt: „Alle Deutschen …“.
Das wirft Fragen auf.
Warum hat eine ausländische Touristengruppe, die von der Polizei rassistisch kontrolliert und schikaniert wurde, kein Recht dagegen zu demonstrieren? (Artikel 8)
Warum haben Saisonarbeiter, die immer nur für ein paar Wochen für einen Hungerlohn und unter übelsten Bedingungen bei uns arbeiten, kein Recht einen polnischen Kulturverein zu gründen, um ihr Elend etwas zu mildern? (Artikel 9 (1))
Warum hat eine Asylbewerberin, die in Berlin untergebracht ist, kein Recht, ihren Bruder in Potsdam zu besuchen? (Artikel 11)
Warum haben so viele Menschen, die in dieses Land kommen, kein Recht, sich Arbeit oder einen Ausbildungsplatz zu suchen? (Artikel 12 (1))
Warum hätte ein Georgi Dimitroff in diesem Land kein Recht auf Widerstand? (Artikel 20 (4))
Warum hat einer, der sich rund um die Uhr um Menschen in seiner Gemeinde kümmert, und dem von dumpfbackigen, widerlichen, reaktionären Bürokraten seit Jahren die Einbürgerung verweigert wird, kein Recht Bürgermeister zu werden? (Artikel 33)
Auf all diese Fragen gibt es immer nur eine Antwort: Weil diese Grundrechte reaktionär verkümmert sind und die bürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz dadurch missachtet wird. Und deshalb muss es heißen:
Alle Grundrechte für alle!
Noch eine Anmerkung: In dieser Liste von Grundrechten nur für Deutsche ist das Wahlrecht nicht vergessen worden – es gehört tatsächlich nicht in diese Kategorie von Grundgesetzartikeln. Das ist schön und macht den Kampf um Veränderung leichter.
|
Grundgesetz der BRD |
Verfassung der DDR von 1949 |
|
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. (2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. |
(1) Alle Bürger haben das Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine oder Gesellschaften zu bilden. (Artikel 12) |
|
(1) Vereinigungen, die die demokratische Gestaltung des öffentlichen Lebens auf der Grundlage dieser Verfassung satzungsgemäß erstreben und deren Organe durch ihre Mitglieder bestimmt werden, sind berechtigt, Wahlvorschläge für die Volksvertretungen der Gemeinden, Kreise und Länder einzureichen. (2) Wahlvorschläge für die Volkskammer dürfen nur die Vereinigungen aufstellen, die nach ihrer Satzung die demokratische Gestaltung des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens der gesamten Republik erstreben und deren Organisation das ganze Staatsgebiet umfaßt. (Artikel 13) |
|
|
(3 Satz 1 und 2) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. |
(1) Das Recht Vereinigungen zur Förderung der Lohn- und Arbeitsbedingungen anzugehören, ist für jedermann gewährleistet. Alle Abreden und Maßnahmen, welche diese Freiheit einschränken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig und verboten. (Artikel 14) |
|
(2) Das Streikrecht der Gewerkschaften ist gewährleistet. (Artikel 14) |
|
|
(1) Die Regelung der Produktion sowie der Lohn- und Arbeitsbedingungen in den Betrieben erfolgt unter maßgeblicher Mitbestimmung der Arbeiter und Angestellten. (2) Die Arbeiter und Angestellten nehmen diese Rechte durch Gewerkschaften und Betriebsräte wahr. (Artikel 17) |
|
|
(3 Satz 3, 1968 eingefügt) Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 911 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. |
|
|
Inhaltliche Unterschiede zwischen beiden Verfassungen sind durch Fettschrift gekennzeichnet. Quellen: www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html und www.documentarchiv.de/ddr/verfddr.html. 1 Es handelt sich um folgende Artikel: 12a: Erweiterung von Dienstpflichten neben der Wehrpflicht 35 Abs.2: Gegenseitige Amtshilfe der Behörden von Bund und Ländern, v.a. Polizei, und auch Bundeswehr 87a Abs.4: Einsatz der Bundeswehr zum Schutz von Objekten und Bekämpfung Aufständischer 91: Einsatz des Bundesgrenzschutzes (inzwischen Bundespolizei) auch gegen den Willen von Bundesländern |
|
2 Verfassung der DDR von 1949, Artikel 12. www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html
Zur Vergleichbarkeit des Grundgesetzes mit der Verfassung der DDR von 1949 siehe Vorwort zu dieser Serie in der KAZ Nr. 373: „Die Verfassung von 1949 war vom Deutschen Volkskongress eigentlich vorgeschlagen als gesamtdeutsche Verfassung für eine Deutsche Demokratische Republik von der Oder bis zum Rhein. Sie fußte noch auf dem kapitalistischen Ausbeutersystem. Da aber gemäß dem Potsdamer Abkommen 1945 zwischen den USA, Großbritannien und der Sowjetunion die Monopole beseitigt, die Kriegsverbrecher enteignet waren, war es ein sehr geschwächter Kapitalismus mit einem großen staatlichen Sektor unter Kontrolle der Arbeiter und Antifaschisten – wobei die Durchführung des Potsdamer Abkommens eben nur im Osten durchgesetzt wurde. Dass es keine gesamtdeutsche DDR gab, dem kam die Gründung der BRD mit ihrer Vorbereitung durch den Parlamentarischen Rat zuvor.
3 25 Jahre DGB – Menschlichkeit und sozialer Fortschritt?, hrsg. Vom ZK des Arbeiterbundes für den Wiederaufbau der KPD, München 1974. Das Zitat von Paul Harig ist aus: Paul Harig, Arbeiter – Gewerkschafter – Kommunist, Frankfurt/Main 1973.
4 Rolf Gross, Streikrecht und Grundgesetz, 1963; zit. nach: library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1963/1963-09-a-559.pdf, siehe auch www.kaz-online.de/artikel/alles-lernen-nichts-vergessen.
5 Ebenda
6 www.kaz-online.de/artikel/tarifeinheit-streikverbot.
Spenden unterstützen die Herausgabe der Kommunistischen Arbeiterzeitung
- KAZ Nr. 375
- Übersicht
- Editorial
- Die Lösung
- Die „faire“ Umverteilung der Krisenlasten auf die Metaller
- Gleicher Lohn für gleiche Arbeit vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH)
- VW: „Arbeitsplatzrettung“ durch Arbeitsplatzvernichtung, Lohnraub und Arbeitshetze
- Besichtigung der Grundrechte
- Wechseljahre – Abschied von der Zukunft! oder Corona hat das Bildungssystem nicht erwischt, sondern ertappt
- Der Virus hat keinen Werksausweis – Oder doch?
- Wer zahlt die Zeche? Was geht ab?
- Europäische Solidarität in der Pandemie: E-Ladesäulen für VW
- Mörderische antibritische Kampagne gegen AstraZeneca
- 2 Euro Volkserziehungsgebühr, bitte!
- 150 Jahre Pariser Kommune
- Über den Drahtzieher hinter den Lügen um den angeblichen „Genozid“ usw. in Xinjiang – 2021/03/09
- Mit zweierlei Maß – je nach dem was politisch nützt!
- Digitale Souveränität – Teil 1
- Heuchlerkartell zu Antisemitismus und Rassismus
- Das Maas ist voll
- Indien in Aufruhr – Arbeiter und Bauern (noch nicht) vereint
- Schicksalsgemeinschaft der Menschheit?! – Ein Vorschlag der chinesischen Führung zur friedlichen Koexistenz
- Eine Pandemie kann nur global bekämpft werden: Gesundheit vor Profite
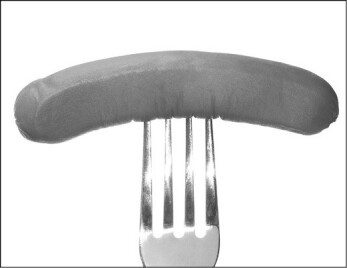
Nutzen wir im Kampf gegen diese Würstchen unsere gemeinsame Kraft und Solidarität.

Streikrecht erkämpfen, indem wir streiken.