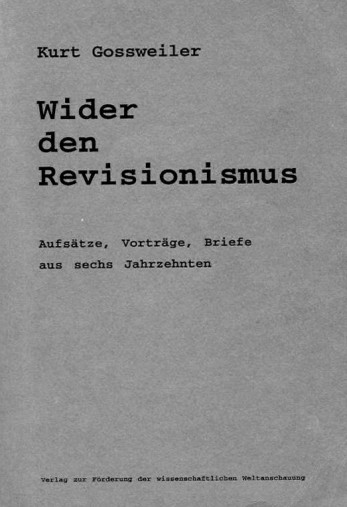KAZ-Fraktion: „Ausrichtung Kommunismus”
Zur Diskussion um die „revisionistische Wende“
Linksradikalismus – Rechtsopportunismus – Konterrevolution
Im Herbst 1989 waren die meisten Kommunisten und Sozialisten der beiden deutschen Staaten überrascht von der Gewalt des „friedlichen Übergangs“ in die gemeinsame imperialistische Gesellschaft. Die konterrevolutionären Kräfte aus der Bundesrepublik konnten– kaum gestützt auf die noch fast namenlosen Kollaborateure in der DDR – den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden und eine der am weitesten entwickelten Länder innerhalb des sozialistischen Lagers ohne nennenswerten Widerstand einverleiben.
Zwar waren zuvor schon Genossen darum bemüht, eine Antwort auf diese Katastrophe zu finden. Allein die Entwicklung der 60er Jahre hatte innerhalb der kommunistischen und sozialistischen Arbeiterbewegung zu erbitterten Auseinandersetzungen innerhalb der eigenen Reihen geführt. Es kam zu schwerwiegenden Spaltungen, die harte ideologische und ökonomische Auswirkungen in den sozialistischen Ländern nach sich zog. Ebenso ergab sich für die dem revolutionären Sozialismus verpflichteten Parteien und Organisationen in den kapitalistischen Ländern aus den einsetzenden Spaltungen ein enormer Verlust an Kampfkraft der eh’ schon durch die politische Unterdrückung geschwächten Bewegung.
Schließlich sahen sich an dieser von der Bourgeoisie ausgerufenen „Zeitenwende“ alle Anhänger des Sozialismus – also die nicht zu Apologeten der herrschenden Verhältnisse Gewandelten – am selben Tisch, ringend um Erkenntnisse und Argumente auf die Fragen: Wie konnte es zu diesem umfassenden Sieg der Konterrevolution kommen? Warum haben wir das nicht vorausgesehen und wurden praktisch völlig überrascht von den konkreten Ereignissen? Was sind die Gründe dafür, dass wir so weitgehend waffen- und wehrlos in diese Ereignisse hineinschlittern konnten?
In dieser von Auflösung und Neuanfang, Verbitterung und Erbitterung gekennzeichneten Situation war es oft genug fast unmöglich, nüchtern und kalkuliert in Diskussionen einzugreifen. Geschweige denn zu organisiertem Handeln überzugehen.
Denjenigen, die in der westdeutschen Linken nicht erst 1989/90 versucht hatten, die Entwicklung seit dem XX. Parteitag der KPdSU mit den eingetretenen Ereignissen in Beziehung zu setzen, schlug eine seltsame Stimmung entgegen. Die scheinbare Befreiung von allen „Dogmen“ einerseits – schon länger z. B. als Etikett und neues Dogma „Anti-Stalinismus“ auf alle möglichen und unmöglichen Zusammenhänge und Organisationen aufgeklebt – kontrastierte auf der anderen Seite mit einer widersprüchlichen Aufbruchseuphorie.
Diejenigen, die sich auf dem Marxismus rückbesinnen wollten, ließen zunehmend an der DDR kein gutes Haar und wollten nur noch „soziale“ Fortschritte als positives Erbe gelten lassen. Eine sich besonders radikal gebärdende Minderheit vertrat sogar die Auffassung, dass der bloße Versuch, in einem Teil Deutschlands den Sozialismus aufzubauen, unvermeidlich in die Niederlage führen musste.
Durch die unbestreitbare Niederlage, durch die Kenntlichkeit der dafür verantwortlichen Personen und durch die Zuspitzung der einsetzenden Debatte unter Druck geraten zogen sich die Verteidiger des „Reformkommunismus“ auf immer unbestimmtere Positionen zurück. Grundsätzlicher Kritik gegenüber waren ihre Positionen seltsam unbestimmt. Oder wurden ihrerseits mit Detailfragen regelrecht unterlaufen und Kritik mit scheinbarem Insiderwissen immer wieder relativiert. Konstant blieb allenfalls die Wiederholung der in die Sinnlosigkeit hineinargumentierten übergroßen Opfer. Die damit tatsächlich oder vermeintlich verbundenen Verfehlungen und Verbrechen wurden eher beschworen als auf eine für alle nachprüfbare Ebene der Debatte gebracht.
Deshalb war es umso wichtiger, dass sich eine Stimme zu Wort meldete, die aus eigenem Erleben und durch eigenes Nach- und Durchdenken der Grundsatzfragen und Probleme die Diskutanten daran erinnerte: Die Ernsthaftigkeit einer Bewegung ist am Verhältnis zu den eigenen Fehlern zu messen und die Grundlage dafür kann nur ein wissenschaftlich fundiertes Herangehen sein.
Es war die Stimme des Genossen Kurt Gossweiler, der bereits mit seiner ersten Buchveröffentlichung zu diesem Thema (Wider den Revisionismus) denen den Rücken stärkte, die Klarheit über die Chruschtschow-Ära erreichen wollten. Und die dies taten in der Überzeugung, dass ohne diese Klarheit weder die Restauration kapitalistischer Verhältnisse in den sozialistischen Ländern zu begreifen ist noch eine nennenswerte revolutionäre Bewegung aus der Niederlage Kraft für einen Neuanfang gewinnen kann.
Beeindruckend und erhellend auch der Kampf um persönliche Einsicht in die Entwicklung der kommunistischen Parteien, offen gelegt und kommentiert in den Tagebuchaufzeichnungen der beiden „Taubenfuß-Chroniken“. Die in ihrer Dramatik diejenigen widerlegen, die allein schon mit dem Wechsel der Führungspersönlichkeiten nach Stalins Tod und der Schockwirkung des XX. Parteitages die Sowjetunion als „sozialimperialistisch“ abgeschrieben hatten, ohne den langwierigen Klassenkampf bis zu ihrer letztendlichen Liquidierung ernsthaft zu untersuchen.
Ein besonders lesenswertes Dokument stellen hier auch die „Wendebriefe“[1] dar, die verdeutlichen, wie reduziert der analytische Umgang mit allen grundlegenden Fragen geworden war. Allein schon dem internationalen Umfang der persönlichen Kontakte und der immer wieder geduldig und beharrlich vorgetragenen Argumentation kann sich kein ernsthaft interessierter Leser entziehen. Das ist nicht nur von daher fesselnd, das ist auch „Futter“ für das eigene Denken, Ansporn, sich wieder den grundlegenden Fragen zuzuwenden. Und den Klärungsprozess als nie endende Diskussion – aber mit Blick in Richtung Kommunismus – zu begreifen.
Umso ernüchternder dann die Reaktion der ewigen Gorbatschow- und Chruschtschow-Verteidiger, die entscheidende Tatsachen und Zusammenhänge zu und zwischen beiden Personen nicht gelten lassen wollen.[2] Ein vorläufiger Höhepunkt in dieser Debatte stellt dann auch die Broschüre des Marxistischen Forums Leipzig mit dem Titel „Die Legende von der revisionistischen Wende“[3] dar. Was hat die Gemüter von Genossen dermaßen erhitzt, die als Kommunisten einer Wahrheitsauffassung verpflichtet sein müssten, die sich aus der nüchternen Anwendung des dialektischen Materialismus und der Beachtung aller Seiten der Widersprüche in bürgerlichen wie sozialistischen Klassengesellschaften ergibt. Eine Hitzigkeit, die den Unterschied zu gewissen „ewigen Wahrheiten“ eines bereits zu Lenins Zeiten selbst ernannten „Genies“[4] in allen revolutionären Fragen regelrecht dahinschwinden lässt?
Eigentlich wenden wir uns doch an die Arbeiterklasse, an das historische Subjekt, an den Träger der von Kommunisten gedachten Gesellschaftsveränderung. Andere denken auch die Veränderung dieser Gesellschaft. Aber innerhalb ihrer beschränkten bürgerlichen Klassen- und Schichtzugehörigkeit und das heißt: nicht für die Arbeiterklasse und nicht für das gesellschaftliche Eigentum.[5]
Als Marx und Engels die Gründe für die Niederlage der Pariser Kommune analysierten, hoben sie zwei Dinge hervor: Die Frage der Macht und die des Eigentums. Es waren zwei Ursachen, die den Untergang der Kommune herbeiführten: den alten Staatsapparat nicht zerschlagen und die Ausbeuterklasse nicht enteignet zu haben. Um auf dem vergesellschafteten Eigentum ihre politische Macht aufrichten zu können. Wieso unternahmen Marx und Engels überhaupt den Versuch, angesichts dieser blutigen und umfassenden Niederlage Schlüsse zu ziehen für künftige revolutionäre Bewegungen?
Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass die Sowjetunion diese entscheidenden Schritte vollzogen hat. Der militärische Sieg über den faschistischen deutschen Imperialismus ist dafür wohl einer der beeindruckensten Beweise. Doch was geschah danach? Der Genosse Gossweiler hat zwei entscheidende Aspekte zur Klärung dieser Frage in die Debatte eingebracht.
Er argumentiert: „Der Kapitalismus ist ein sich selbst regulierendes System, dessen Gesetzen die Menschen unterworfen sind. Der Sozialismus ist in Theorie und Praxis eine Wissenschaft. Der sozialistische Aufbau muss also auch wissenschaftlich betrieben werden, d.h., der sozialistische Politiker und Ökonom muss die Gesetze der Entwicklung der Gesellschaft und die ökonomischen Gesetze des Sozialismus kennen und darauf seine Politik aufbauen.
Oder anders gesagt: Während der Prozess der Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus ein spontaner Prozess ist, ist der Prozess der Errichtung und Entwicklung des Sozialismus ein bewusster, organisierter Prozess.
Das aber bedeutet, dass die Führungsqualitäten der führenden Persönlichkeiten im Sozialismus eine für das Schicksal des Sozialismus, für das Gelingen oder das Scheitern des sozialistischen Aufbaus, entscheidende Rolle spielen.“[6]
Und er bezieht sich auf Lenin: „Besonders bemerkenswert fand ich folgende Ausführungen Lenins: ,Das wichtigste Kampffeld gegen uns ist für unsere Gegner aus dem kleinbürgerlichen Lager das Gebiet der inneren Politik und des wirtschaftlichen Aufbaus. Ihre Waffe ist – die Untergrabung all dessen, was das Proletariat dekretiert und beim Aufbau der organisierten sozialistischen Wirtschaft durchzuführen sucht. Hier tritt die kleinbürgerliche Anarchie – die Anarchie der kleinen Eigentümer und des zügellosen Egoismus – als entschiedener Feind des Proletariats auf.’
Lenin hat mehrfach betont, dass es leichter ist, die Bourgeoisie zu stürzen, als diese Elementargewalt der kleinbürgerlichen Anarchie zu bändigen. Die Erfahrungen, die wir von 1941-1945 und von 1955-1990 machen konnten und machen mussten, zeigen die Umkehrung dieser Feststellung: Den Sozialismus zu stürzen ist viel schwerer durch einen offenen konterrevolutionären Angriff als durch die Wiederbelebung und Entfesselung dieser kleinbürgerlichen Elementargewalt.“[7]
Die historische Erfahrung zeigt, dass die kleinbürgerlichen Kräfte, auch wenn sie den sozialistischen Weg mit beschritten haben, auf der Grundlage der kapitalistischen Kleinproduktion immer wieder zum Privateigentum zurückkehren, wenn man sie gewähren lässt[8] .
Nun – wie wäre es denn dann, wenn man in der Bestimmung der Aufgaben der noch jungen, unerfahrenen und instabilen Sowjetmacht durch Lenin im April 1918 erkennen wollte, dass alle politischen Strömungen mit ihren ultralinken und rechtsopportunistischen Schwankungen als Ausdruck realer Widersprüche damals bereits existierten, sich immer wieder bei neu entstehenden Problemen und Entscheidungssituationen ideologisch und praktisch – gerade innerhalb der Partei – neu formierten und artikulierten? Und wie wäre es, wenn man Lenins Durchsetzungsvermögen in seiner dialektischen Kritik – ebenso umfassend wie leidenschaftlich vorgetragen – suchen würde? Denn seine ungebrochene und sich in allen Fragen stets erneuernde Parteilichkeit für die Interessen des Proletariats – dem eigentlichen gesellschaftlichen Produzenten – war die Grundlage für die sich entwickelnde Sowjetunion und der Garant für ihre weitere Stabilisierung auf dem Weg zum Kommunismus.
Wie wäre es, wenn man die Entwicklung des Landes und der Partei unter Stalins Führung daran messen würde, wie wenig man – bezogen auf die voranstehend genannten Strömungen und Fraktionierungen – hier noch von Fehlern aus Mangel an Erfahrung sprechen konnte? Sondern vom unbelehrbaren Festhalten und Wiederholen von Positionen sprechen muss, die – sowohl innerhalb wie außerhalb der Partei in der Arbeiterklasse ohne nennenswerte Unterstützung – unweigerlich eine Zuspitzung der Auseinandersetzung und der praktisch zu ziehenden Konsequenzen nach sich zogen? Wo Mord, Subversion und Putschversuch die jämmerliche Isolation und den kläglichen Übergang der so handelnden Personen auf die Seite der Konterrevolution markierten. Wie wäre es eigentlich, wenn einmal das Tun und Denken der gegen die Führung der KPdSU gerichteten Opposition untersucht würde statt sich vor lauter Anti-Stalin das Hirn vernebeln zu lassen?[9]
Und wie wäre es, wenn man – nicht nur reduziert auf die Oktoberrevolution – andere Erfahrungen wie die chinesische Revolution in die Debatte mit einbeziehen würde? Eine Revolution, die – auf den Schultern von Marx, Engels, Lenin und Stalin stehend[10] – den kritischen Umgang mit Fehlern und Versäumnissen nutzte, die Entwicklung des Sozialismus voranzutreiben und durch ihren Beitrag die Frage der Kulturrevolution von der bloß nachholenden Entwicklung wieder auf die Stufe der vorantreibenden Kraft hob.
Wie wäre es in diesem Zusammenhang auch damit, die kommunistische Partei nicht wie einen „Gott“ zu behandeln, sondern als eine revolutionäre Organisation, die auch die jeweilige Zusammensetzung und Entwicklungsstufe der Gesellschaft widerspiegelt? Und sich daran erinnert und auch erinnern lässt, dass der Sozialismus der gesellschaftliche Weg ist, der über eine ganze und ziemlich lange Periode das Ziel des Kommunismus – die klassenlose Gesellschaft – erreichen will? Und dabei – wenn die Klassenfrage gar nicht bzw. nicht immer wieder neu gestellt wird – so fürchterlich und mit brutaler Konsequenz scheitern kann, wie wir es nicht nur am Beispiel der Länder der ehemaligen Sowjetunion, sondern nach 1989/90 auch am eigenen Leib erfahren müssen.
Fraktion Ausrichtung Kommunismus –
Turvy und Karlchen
1 Siehe dazu: Kurt Gossweiler, Wendebriefe – Briefe gegen die „Wende“ genannte Konterrevolution (Offensiv Nr. 4/2005)
2 Siehe dazu: Kurt Gossweiler, Brief an Robert Steigerwald (Offensiv Nr. 7/2006)
3 Marxistisches Forum Heft 56, Die Legende von der revisionistischen Legende, Leipzig Juni 2008.
4 Trotzkis Selbsteinschätzung in: Sayers/Kahn, Die Verschwörung der Rechten und Trotzkisten gegen die Sowjetunion 1926-1936, S. 213 ff – Der Weg zum Verrat, Rotfront-Verlag Kiel 1972)
5 Marx/Engels Werke Bd.4, Berlin 1972, Das Kommunistische Manifest, S. 482 ff, Kapitel III, „Sozialistische und Kommunistische Literatur“.
6 Kurt Gossweiler, Zur Rolle Stalins und zum Anteil des Chruschtschow-Revisionismus an der Zerstörung der Sowjetunion. Vortrag, gehalten am 27. März 2004 in Bernburg.
7 Dieses Referat Lenins ist auch – mit einer nicht wort-identischen Übersetzung – zu finden in: W. I. Lenin, Werke, Bd. 27. Das angeführte Zitate steht dort auf den S.275 (zitiert nach: Kurt Gossweiler, Wendebriefe – Briefe gegen die „Wende“ genannte Konterrevolution, Offensiv Nr. 4/2005, An Peter Gingold, Frankfurt/M, 05. 05. 1990)
8 „Und die, die den Sieg über die Kapitalisten so sehen, wie das die Kleineigentümer tun – „die haben gerafft, nun lasst auch mich die Gelegenheit wahrnehmen“ – sind doch jeder die Quelle einer neuen Generation von Bourgeois.“ (LW Bd. 27, S.290f, Tagung des gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees)
9 siehe auch: Sayers/Kahn, Die Verschwörung der Rechten und Trotzkisten gegen die Sowjetunion 1926-1936, Rotfront-Verlag Kiel 1972
10 nachzulesen in: Die Polemik über die Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung, Oberbaumverlag Berlin 1973
Die wichtigsten Schriften von Kurt Gossweiler zur Revisionismus-Debatte
Wider den Revisionismus – Aufsätze, Vorträge, Briefe aus sechs Jahrzehnten. Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung München 1997.
Die Taubenfuß-Chronik in 2 Bänden, Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung München 2002 und 2005.
Wendebriefe – Briefe gegen die „Wende“ genannte Konterrevolution (Offensiv Nr. 4/2005).
Brief an Robert Steigerwald (Offensiv Nr. 7/2006).
Spenden unterstützen die Herausgabe der Kommunistischen Arbeiterzeitung
- KAZ Nr. 329
- Übersicht
- Editorial
- Das Lied von der Erde (Kometen-Song)
- Inhalt
- Sie wollen nur Dein Bestes: Dein Geld, Deine Gesundheit, Dein Leben!
- Fakten und Quellen
- Granatsplitter aus dem alltäglichen Imperialismus
- Der Niedergang der SPD hat Name, Anschrift und Gesicht
- „Quelle“ helfen – und wer etwas davon hat
- Elsässers Initiative – Was wir trotzdem daraus lernen können
- Leserbrief zu „Historischer Eintopfsonntag“ in antifa – Dez./Nov. 2009
- Molotows Enkel zum Nichtangriffsvertrag: „Er hat nie bereut, ihn unterschrieben zu haben!“
- Linksradikalismus – Rechtsopportunismus – Konterrevolution
- Vorwort zu „Die Große Proletarische Kulturrevolution – Chinas Kampf um den Sozialismus“
- Und sie bewegt sich doch ...
- Karmann am Ende – „VW Osnabrück“ am Start
- Wessen Sieg?
- Warum wir jubeln statt (ge-)denken sollen
- Für ein gemeinsames Statement: Der Hauptfeind steht im eigenen Land!
- Der Hauptfeind steht im
- Von Menschen und Eseln
- „Das sollten wir unbedingt wiederholen!“
- Unsere Herren, wissen was sie tun!

Bestreiten, relativieren, liberalisieren – alte Rezepte neu aufgelegt für eine erneuerte Zukunft der revolutionären Bewegung?