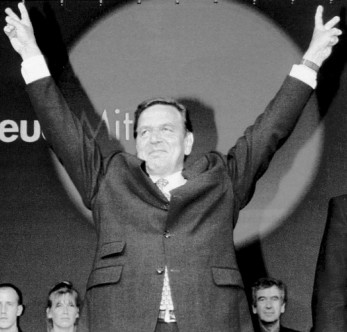Das Schröder-Blair-Papier:
„Hier geht es nun um europäische Innenpolitik ...’’ [1]
Mit diesen Worten kommentierte Christian Gaiser, SPD-Referent für Westeuropa und zuständig für die politischen Kontakte zu Frankreich, die Auseinandersetzung um den Inhalt des sog. Schröder-Blair-Papiers auf dem Treffen der sozialdemokratischen Parteien in Paris. Mit dem im Juni ‘99 veröffentlichten Papier hatten sich die englischen und deutschen Sozialdemokraten uneingeschränkt zum nationalen Flügel ihres Finanzkapitals erklärt, während die französichen Sozialisten – unter dem Druck von Demonstrationen und Streiks – am „regulierten“ und „sozial gezähmten“ Kapitalismus festhielten. Deutlicher als die Erklärung selbst bringt diese Formulierung die außenpolitische Bedeutung auf den Punkt: Deutscher Vormachtanspruch im schärfer werdenen Konkurrenzkampf der nationalen Kapitalfraktionen, jederzeit auswechselbare Koalitionen im Kampf gegen den US-Imperialismus.
„Sie haben einfach alles“[2], schwärmte ein Börsenfachmann über den Zusammenschluß von Boeing und McDonnell Douglas (MDD) im Dezember 1996. Er meinte damit nicht nur die Marktanteile – den ersten Platz in der Produktion von Verkehrsflugzeugen (Boeing) und die Option auf einen vorderen Platz in der Rüstungsproduktion (MDD). Die Aktienkurse beider Firmen schnellten an der Börse in die Höhe. Ebenso die Hoffnungen, in Europa weiterhin fliegendes Verkehrs- und Kriegsgerät im gewohnten Umfang verkaufen zu können. Es galt einen Angriff abzuwehren: die Airbus-Familie und der Eurofighter sind der technische Ausdruck einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die jahrzehntelang gehaltene Führungsrolle der amerikanischen Luftfahrtindustrie.
Der Zusammenschluß löste bei der DASA sofort hektische Reaktionen aus. Es ging eben um mehr als sichere Marktanteile, es ging um die Führungsrolle (siehe auch „Imperialistische Allianzen“). In Europa hat die DASA sie bereits erreicht und sprengt immer wieder die Beschränkungen, die sie bei der Gründung des Airbus-Konsortiums Mitte der 60er Jahre noch hinnehmen mußte. Die amerikanische Großfusion bot die willkommene und notwendige Gelegenheit, die Positionen nach den inzwischen realen Machtpositionen neu zu bestimmen.
Eingeläutet wurde die erste Runde mit dem Hinweis auf die bestehende Airbus-Organisationsstruktur: „Beim Airbus soll zusammenwachsen, was nur schwer zusammenpaßt: Mit der DASA und British Aerospace treffen zwei Privatkonzerne auf die beiden Staatsunternehmen Casa und Aérospatiale.“[3]
Die Flug-Revue, das Leib- und Magenblatt der deutschen Luftfahrtindustrie, erläutert, worum es wirklich geht: „Was also gibt es in Europa zu tun? Zunächst müssen die Hausaufgaben bei Airbus gemacht werden. ... Widerstände kommen dabei zur Zeit aus Frankreich und werden vor allem Aérospatiale-Chef Michon zugeschrieben: Die nationalen Kapazitäten könnten nicht in die Hände eines internationalen Unternehmens ohne staatliche Einflußnahme geraten.“[4] Und der Vorstandsvorsitzende der DASA, Manfred Bischoff, wird von der SZ zitiert: „Nun sei die Politik an der Reihe. ... Da zwei der vier Partner im Staatsbesitz sind, müsse dies auf Regierungsebene vorangebracht werden.“[5]
Von der Kohl-Regierung, in Grabenkämpfe um Renten- und „Sozialstaat“-Debatten verwickelt, war weder finanzielle noch politische Hilfe zu erwarten. Im Mai 1997 hämmert die Flug-Revue erneut gegen geschlossene Türen: „Mehr Konzentration bitte!“ Und titelt im Innenteil forsch mit der Forderung nach Kampf „bis aufs Messer!“ Gegen Boeing versteht sich.
Die SPD stellt ihr feines Gehör unter Beweis und baut für den möglichen Regierungswechsel vor. Die Bundestagsfraktion läßt über ihre Fraktionssprecher auf einer Expertenanhörung erklären, daß „das Ziel einer kostensenkenden Neustrukturierung der Airbus-Gruppe als europäischer Konzern ohne flankierende Hilfen der jeweiligen Regierungen nicht zu erreichen“ und „die Ausschöpfung aller rechtlich möglichen Staatshilfen unerläßlich“[6] sei. Inzwischen steigt der Entscheidungsdruck für Aérospatiale, den französischen Teilhaber im Airbus-Konsortium. Für das Jahr ’98 wird ein Auftragsboom erwartet, hohe Gewinne locken. Gleichzeitig versucht die DASA mit Matra ins Geschäft zu kommen, einem Unternehmen der mit Aérospatiale konkurrierenden Lagadère-Gruppe. Das Aufschieben der Neuorganisation könnte das gute Geschäft verderben. Vorentscheidungen für die Planung des Jumbo-Airbus A3XX, mit dem Boeing aus dem Markt für Großraumflugzeuge gedrängt werden soll, müssen getroffen werden.
„Neue Jobs durch Riesen-Airbus?“[7] stellt die Schlagzeile der Augsburger Allgemeinen im Januar ’98 in Aussicht, mit Speck fängt man bekanntlich Mäuse. Gerade die Auseinandersetzung um das Konkurrenz- und Nachfolgemuster für die Boeing 747 beherrscht bis ins Jahr ’99 die Diskussion um die Zukunft der Airbus-Gruppe.
In diese Atmosphäre hinein plazieren Schröder und Blair nun ihren Vorschlag in Form einer gemeinsamen Erklärung, die „den Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten weisen soll“. Zwar vermeidet das Papier jeden direkten Bezug auf außenpolitische Themen. Aber allein schon der Umstand, daß sich beide nicht mit den französischen Sozialisten absprechen, muß von diesen als Provokation empfunden werden. Es läßt die über die staatliche Aérospatiale am Airbus beteiligte französische Regierung als Vertreter einer überholten sozialen Romantik erscheinen, die den bisher erreichten Airbus-Erfolg im Konkurrentkampf mit Boeing aufs Spiel setzt. Angesichts der Tatsache, daß der deutsche und englische Teil des Airbus-Konzerns bereits kräftig durchrationalisiert wurden, ist die Aufforderung, „sich den objektiv veränderte(n) Bedingungen anzupassen“[8], eindeutig: die staatlich garantierte Sicherung von Arbeitsplätzen ist schierer Luxus. „Wir müssen unsere Politik in einem neuen, auf den heutigen Stand gebrachten wirtschaftlichen Rahmen betreiben, innerhalb dessen der Staat die Wirtschaft nach Kräften fördert, sich aber nie als Ersatz für die Wirtschaft betrachtet.“[8] Stellt man diese Aussage der Aufforderung in der deutschen Presse gegenüber, endlich seine „Hausaufgaben“ zu machen, ist kein Zweifel mehr möglich.
Die Erklärung, daß man vom „Dogma von Links und Rechts“ loskommen müsse, daß Werte wie „soziale Gerechtigkeit“, „Chancengleichheit“ und „Solidarität“ „zeitlos“[8] seien, machen solche „Werte“ nutzlos, weil sie den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit leugnen. Außerdem: auch wenn Schröder mit dem Gestus des großen Staatsmannes daherkommt und die Aura souveräner Richtlinienkompetenz verbreitet, er bleibt doch nur ein Butler in der Pose eines deutschen Napoleons, der die Interessen nicht nur der deutschen Autoindustrie und der mit ihr verbundenen Banken vollzieht.
Ein gut unterrichteter und daher namenloser British-Aerospace-Manager wurde im August ‘97 von der Flug-Revue dabei beobachtet, wie er sich sehr weit aus dem Fenster lehnte: „Wenn von französischer Seite nicht bald andere Signale kommen, dann könnten sich gewisse Realitäten sehr schnell sehr nachhaltig verändern. Es ließen sich durchaus andere Seilschaften (!) gründen, an deren Ende dann Frankreich draußen vor der Türe stünde.“[9] Nun ist Aérospatiale durch die „Türe“ des neuen Airbus-Konzerns, der EADS, gegangen und British Aerospace aus dem Fenster gefallen und an der EADS nicht einmal mehr beteiligt. Man sieht, wie „zeitlos“ die Werte Chancengleichheit und Solidarität unter Imperialisten sind.
Norbert Burgner, der Chefredakteur der Flug-Revue, darf einen hämischen Nachruf verfassen auf die Ausstiegsklausel, die die DASA in den Vertrag hat aufnehmen lassen, und ihre gewollten Wirkungen:
„Die vermeintliche Vorsichtsmaßnahme der DASA ist weniger tumbes Mißtrauensvotum als vielmehr Ergebnis geschickten ... Kalküls.
Denn die Ausstiegsklausel ist nicht im Sinne des Wortes zu verstehen. Im Falle einer Nichtumsetzung der Forderung nach Rückzug des französischen Staates bis spätestens 2003 wird sich nicht die DASA aus der EADS verabschieden, sondern Frankreich ist verpflichtet, die Luft- und Raumfahrttochter von Daimler-Chrysler zu kaufen.
Bei einem Marktwert der EADS von rund 60 Milliarden DM (dem 1,5fachen des Umsatzes) müsste der Elysée-Palast für die mit besagten 30 Prozent beteiligte DASA 20 Milliarden DM auf den Tisch legen. Weil er das nicht wird leisten können, wird er sich aus dem Geschäft zurückziehen - ganz so wie Manfred Bischoff es immer haben wollte.“[10]
Und ganz nebenbei verweist er die französische Regierung auch gleich auf den gewünschten politischen Notausgang: „Die französische Regierung wird planmäßig auch nicht im ... EADS-Aufsichtsrat vertreten sein. So braucht man sich vom Wähler nichts vorwerfen zu lassen, wenn Aérospatiale im Rahmen der Fusion demnächst die Entlassungswelle des unabdingbaren Rationalisierungsprogramms à la Dolores erfasst.“[10] Geradezu berauscht von Größenwahn schließt er seinen Kommentar mit den Worten: „Das Leben ist schön.“[10]
Arbeitsgruppe Widersprüche
zwischen den Imperialisten
1 Zitiert nach: Freitag Nr.49/3.12.99.
2 Die Zeit Nr.52/20.12.96, „Formation gegen Airbus“.
3 Der Spiegel Nr.52/23.12.96.
4 Flug-Revue Nr.2/Febr.97, „Elephantenhochzeit“.
5 Süddeutsche Zeitung Nr.37/14.2.97, „Mit dem Airbus hebt auch die Dasa ab“.
6 Süddeutsche Zeitung Nr.104/7.5.97, „Airbus muß unter ein Konzerndach“.
7 Augsburger Allgemeine Nr.22/28.1.99.
8 Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten, ein Vorschlag von Gerhard Schröder und Tony Blair, Seite 1.
9 Flug-Revue Nr.8/August 1997, „Ambition und Strategie“.
10 Flug-Revue Nr.12/Dezember 1999, „Zur Gründung der EADS bleibt alles anders“.
Was wird aus den Arbeitsplätzen bei DASA und Aérospatiale?
Das sog. Schröder-Blair-Papier liefert mit seiner verhüllten Drohung, „ein einziger Arbeitsplatz fürs ganze Leben ist Vergangenheit“[1], der aggressiv expandierenden DASA die Rechtfertigungs- und Handlungsgrundlage: der eigenen Belegschaft das Fell über die Ohren zu ziehen und dann den französischen Kollegen mit dem Hinweis auf „größere Kosteneffektivität und Flexibilität“ das gleiche abzuverlangen. Die Geschäftsleitung der Aérospatiale wird hier nicht lange Widerstand leisten, denn sie will ja auch vom expandierenden Geschäft profitieren. Ihr Zögern gilt nur der einen Frage: Sind wir gleichermaßen daran beteiligt oder ziehen wir bei der Macht- und Gewinnkalkulation das kürzere Ende?
Mit dem Personaleinsparungsprogramm „Dolores“ hatte die DASA die Belegschaft bereits kräftig abgebaut. Die Behauptung, daß die wegrationalisierten Arbeitsplätze die verbliebenen sichern würden, ist nichts wert. Denn der Abbau war eine Voraussetzung dafür, in den verschärften Konkurrenzkampf mit Boeing eintreten zu können. Mit dem Bau des Super-Airbus A3XX beginnt die Konkurrenz um höhere Produktivität für höhere Profite erneut. Selbst der kurzfristige Anstieg der Arbeitsplätze im einen oder anderen Konzernbereich wird dann erneut in Frage gestellt. Unterm Strich bleibt langfristig das, was seit der Gründung des Airbus-Konsortiums feststeht: die Zahl der Arbeitsplätze sinkt beständig - sichtbarer Ausdruck der stets zunehmenden Produktivität der einzelnen Arbeitskraft. Und der Tatsache geschuldet, daß nur die zunehmende Ausbeutung der lebendigen Arbeitskraft Quelle für die Steigerung des Profits sein kann.
Was läßt sich als Ergebnis festhalten? Das Stillhalten und die nationalistische Begleitmusik zur „Standortsicherung“ seitens der DASA-Betriebsräte hat nur die Kassen der DASA gefüllt und den Vorstandsvorsitzenden Bischoff ermutigt und bestärkt, gegenüber Belegschaft und Geschäftsleitung der Aérospatiale sowie der französischen Regierung gehörig auf den Putz zu hauen: „Wir fühlen uns nicht als Schrumpfgermanen.“[2]
Die DASA steht innerhalb des neuen Konzerns stärker da als je zuvor - gegenüber der französischen Regierung, dem französischen Kapital, den französischen und deutschen Belegschaften.
1 Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten, ein Vorschlag von Gerhard Schröder und Tony Blair, S.4.
2 Augsburger Allgemeine Nr.23/29.1.99.
Spenden unterstützen die Herausgabe der Kommunistischen Arbeiterzeitung
- KAZ Nr. 294
- Übersicht
- Editorial
- Grabschrift für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
- INHALT
- Thesen zu Imperialismus und Nationalismus in Jugoslawien
- Daimler/DASA und Aérospatiale: Mit Frankreich contra USA?!
- „Hier geht es nun um europäische Innenpolitik ...’’ 1
- Der Kampf der britischen Vodafone AirTouch gegen die deutsche Mannesmann AG – unser Kampf?
- Krieg gleich Krieg?
- Italien, die Balkanländer und der Schmuggel
- Entschädigung von Zwangsarbeitern - nach Gutsherrenart?
- Wessen Nutzen, wessen Schaden?
- Erinnerungen an die DDR im Klassenkampf
- Nachkriegszeit - Vorkriegszeit
- Demokratismus gegen Demoralisierung
- Proklamation der Nationalversammlung des Poder Popular der Republik Kuba
- Aufstehen! Debout! Sta op!
- „Räterepublik München 1918–1919’’
- 90 Jahre Clara-Zetkin-Haus
- Großdemonstration zum Jahrestag der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
- Weg mit dem Embargo gegen Jugoslawien! Hilfe für Kragujevac!